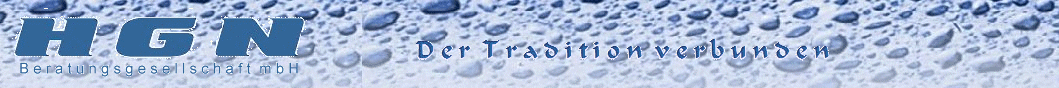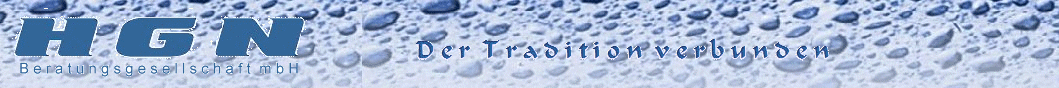|
Zur
Berechnung der Grundwasservorräte
von DR. NORBERT MEINERT
(Gekürzt aus einem Vortrag zum
Gedenkkolloquiums für Prof. Dr. Friedrich Stammberger anlässlich seines
100. Geburtstages am 15. Mai 2008 an der
TU Bergakademie Freiberg;
kpl. veröff. GEOHISTORICA, Heft 4/2009)
In den ersten Jahren
nach dem Ende des 2. Weltkrieges standen in der DDR zunächst die
Wiederherstellung der zerstörten kommunalen Trinkwasserversorgungen
sowie in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts die Verbesserung
der Wasserversorgung in den ländlichen Gebieten im Vordergrund (Gruppenwasserversorgungen,
Rinderoffenställe etc.).
Ein deutlicher
Entwicklungsschub vollzog sich mit dem Inkrafttreten des „Kohle- und
Energieprogramms“ ab etwa 1957.
Die Wasserwirtschaft
entwickelte zur Absicherung der Wasserversorgung in den für den
Braunkohleabbau vorgesehenen Gebieten der Lausitz und des
mitteldeutschen Raumes sowie der Kraftwerksstandorte u. a. die Konzepte
für Fernwasserversorgungen (FWV Lausitz, FWV Elbaue, FWV Rappbodetalsperre u.a.).
Diese Konzepte
erforderten ebenso wie der Aus- und Aufbau der Industriestandorte
Petrochemisches Kombinat und Papierfabrik Schwedt, Eisenhüttenkombinat
Stalinstadt, Chemiewerke Premnitz, Leuna, Bitterfeld sowie die
Notwendigkeit der Verbesserung der Trinkwasserversorgungen Rostock,
Berlin, Magdeburg, Dresden u. a. deutlich qualifiziertere und
umfangreichere Aussagen zur hydrogeologischen Situation und zu den
dauerhaften GW-Gewinnungsmöglichkeiten als die Jahre zuvor.
Die Beanspruchung des
Wasserhaushaltes erfuhr durch diese Programme sowie durch die künstliche
Bewässerung der sich intensiv entwickelnden Landwirtschaft eine
kritische Belastung.
Auf Grund der ungünstigen klimatischen Wasserbilanz betrug das
potenzielle Wasserdargebot in der DDR pro Einwohner nur 880 m³/Ew*a und
der Nutzungsgrad erreichte 36 % (BRD 1.750 m³/Ew*a.; Nutzungsgrad 15 %). Diese naturbedingte Restriktion des verfügbaren Wasserdargebotes auf der
einen sowie der hohe spezifische Wasserverbrauch von Industrie und Landwirtschaft
auf der anderen Seite führten zu einer Konfliktsituation bezüglich der
zeitlich und ortsbezogenen quantitativ und qualitativ ausreichenden
Wasserbereitstellung. Die Situation verschärfte sich in den Folgejahren.
Mehrfachnutzung und nicht ausreichende Abwasserreinigung führten zu
negativen Beschaffenheitsentwicklungen in den Gewässern. Das war dann
auch der objektive Grund dafür, dass die Erkundung und Erschließung von
Grundwasserressourcen zunehmend an Bedeutung gewannen und die
Anforderungen an die Genauigkeit bzw. Zuverlässigkeit der
Erkundungsergebnisse ständig zunahm.
Diese naturgegebene
Randbedingung des begrenzten potenziellen Wasserdargebotes forderte
einerseits den schonenden Umgang mit den Wasserressourcen sowie
andererseits intensive Forschungsarbeiten und eine hohe Genauigkeit für
den Nachweis der gewinnbaren Grundwasserentnahmen nahezu zwingend heraus.
Das war objektiv gesehen auch der Grund dafür, dass in der DDR nicht nur
im Vergleich innerhalb des RGW sondern auch z.B. zur alten BRD ein hoher
regionaler Kenntnisstand (Flächendeckende Hydrogeologische
Übersichtskarte 1 : 200 000 bereits 1968 – in der BRD erst 2004 !) sowie
hohe Standards für Erkundung und Berechnung sich entwickelten und
schließlich auch erreicht wurden.
Die GW-Klassifikation der GW-Vorräte und die Instruktion zur Anwendung
der Klassifikation bildeten dabei einen verbindlichen Rahmen für die
Vereinheitlichung, Vergleichbarkeit und Qualitätsverbesserung der
GW-Vorratsberechnungen einschließlich ihrer umfassenden und
transparenten Dokumentation. Die integere Persönlichkeit von F. Stammberger und seine Fähigkeit, sein umfassendes Wissen mit Logik und
seiner Lebenserfahrung für eine konsequente Umsetzung der Klassifikation
zu nutzen, hatten einen entscheidenden
Einfluss.
Die
Zentrale Vorratskommission (ZVK und später die Staatliche
Vorratskommission StVK) war eine Autoritätsinstitution. Trotz
wirtschaftlicher und politischer Restriktionen und Zielstellungen der
Tagespolitik wurden stets Aspekte der Zukunft beachtet. Für
wissenschaftliche neue Erkenntnisse war man offen. Umweltschutz (Auswirkungen
des Grundwassereingriffs auch auf andere aquatische Systeme wie
Oberflächengewässer, Feucht- und Naturschutzgebiete) sowie die Relation
von Aufwand und Nutzen bzw. volkswirtschaftlicher Effizienz waren stets
im Blickfeld der Beurteilungen und Entscheidungen (Geologisch-ökonomische
Analyse). Nicht ohne Grund waren bestätigte Grundwasservorräte eine
zwingende Voraussetzung für die Durchführung wasserwirtschaftlicher
Investitionen.
Auf Initiative von H.-J. Weder und mit
Unterstützung von H. Hetzer begannen Verhandlungen mit den Organen der
Wasserwirtschaft. Im Mittelpunkt stand dabei der Doppelcharakter des
Grundwassers, das einerseits Bodenschatz und andererseits durch die
Einbindung in den meteorologischen Wasserkreislauf Teil der Gewässer ist.
H.-J. Weder begründetet die Zuständigkeit
der Geologie ausführlich und kam zu dem Schluss:
„
... dass
Grundwasserlagerstätten prinzipiell gleichen Gesetzen unterliegen wie
Lagerstätten anderer Minerale und dass sich aus der Gebundenheit an den
Wasserkreislauf nur eine Besonderheit des Grundwassers ergibt, die bei
hydrogeologischen Untersuchungen zusätzlich zu berücksichtigen ist ... .“
[WEDER,
H.-J.: Zur Grundwasserklassifikation. – Z. angew. Geol., 8, S. 401 –
404, Berlin 1962]
Es begann ein Disput zwischen dem Amt für
Wasserwirtschaft und der Staatlichen Geologischen Kommission bezüglich
der Zuständigkeit für das Grundwasser.
Eine gemeinsame Arbeitsgruppe wurde zur
Lösung der Probleme gebildet. Die erfolgreiche Tätigkeit dieser
Arbeitsgruppe dokumentiert die 9. Jahrestagung der Geologischen
Gesellschaft in der DDR im Mai 1962:
„Dabei
wurde davon ausgegangen, dass das Grundwasser wegen seiner Teilnahme am
allgemeinen Wasserkreislauf einerseits zu den Gewässern zu rechnen ist,
andererseits aber als für sich getrennt gewinn- und nutzbarer Teil der
Erdrinde auch den Charakter des Bodenschatzes hat. ... Seine Erforschung,
Erfassung, Bilanzierung und Beherrschung ist nur in sinnvollem
Zusammenwirken der Wasserwirtschaft mit der Hydrologie zu erreichen.“
[ROCHLITZER,
J.,: Die Anforderungen der Wasserwirtschaft an die Hydrogeologie zur
Sicherung des für die Entwicklung der Volkswirtschaft notwendigen
Wasserbedarfs. - Berichte der Geologischen Gesellschaft in der DDR, 8.
Band, Heft 1, S. 16 – 29, Berlin 1963]
Die Abgrenzung der Zuständigkeiten sowie
die Grundsätze der Zusammenarbeit wurden schließlich in einer ersten
Vereinbarung zwischen dem Amt für Wasserwirtschaft und der Staatlichen
Geologischen Kommission 1962 fixiert.
Die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden
Vorstellungen zur Grundwasservorratsklassifikation wurden in einer
Arbeitsgruppe der ZVK unter Leitung von Prof. Friedrich Stammberger
diskutiert und für die Veröffentlichung vorbereitet. Dieser Prozess war
sehr zäh und von sehr kontroversen fachlichen Standpunkten geprägt. Als
ein Mitglied dieser Arbeitsgruppe erinnert sich der Autor lebhaft dieser
Diskussionen.
Bestechend waren die Logik und die
konsequente, prägnante sprachliche und fachliche Diskussionsführung von
F. Stammberger. Obwohl er bezüglich des Grundwassers als „Seiteneinsteiger“
zu bezeichnen war, belegt ein Artikel von 1966 diese Eigenschaften bzw.
die vom Autor empfundene Qualität der Verhandlungsführung und Kompetenz.
In einem Artikel
[STAMMBERGER,
F.: Einige grundsätzliche Bemerkungen zur ersten
Grundwasservorratsklassifikation der DDR. –
Z. angew. Geol.,
12, S. 415 – 421, Berlin 1966]
schätzt F. Stammberger die zwischen
1961 und 1963 geführte Diskussion ein und bereitet damit die
Verabschiedung einer Grundwasservorratsklassifikation vor. Klare
Begriffsdefinitionen vermisst er und setzt diese
berechtigterweise für eine
erfolgreiche Verständigung voraus. In seiner wissenschaftlichen
Gründlichkeit geht er auf die Klassiker der deutschen Hydrologie und
Wasserwirtschaft zurück und leitet davon ausgehend seinen Standpunkt und
seine Vorschläge zu den aktuell notwendigen Begriffsdefinitionen ab.
„Dieses Kapitel kann
nicht abgeschlossen werden, ohne eine nicht uninteressante Wissenslücke
unserer Hydrogeologen zu erwähnen. Ihre Forderung nach der Schaffung
einer Grundwasservorratsklassifikation wurde nicht selten mit Hinweisen
auf entsprechende Dokumente in den befreundeten sozialistischen Ländern
insbesondere in der UdSSR begründet. Nun gibt es in der Sowjetunion bis
heute jedoch weder eine Vorratsklassifikation für „Grundwasser“ noch für
„unterirdisches Wasser.“
[STAMMBERGER,
F. 1966: s. o.]
Er weist zwei Ursachen für die
Wissenslücken oder besser für die Missverständnisse nach. Die seit 1960
geltende „Klassifikation der Exploitationsvorräte des unterirdischen
Wassers“ bezieht sich zum einen nicht auf das Grundwasser nach
sowjetischer Definition und zum anderen nur auf das Liefervermögen.
In der sowjetischen Hydrogeologie wird
zwischen Grundwasser und Unterirdischem Wasser unterschieden. Das
erstere wird dem ersten unbedeckten Grundwasserleiter zugeordnet und
eine unmittelbare Verbindung zu den Oberflächengewässern postuliert. F. Stammberger
anerkennt dagegen die Einheit von Grund- und
Oberflächenwassersystemen unabhängig von der geologischen Position der
Grundwasserleiter und dem bereits definierten Doppelcharakter des
Grundwassers.
Der Begriff Exploitationsvorräte wurde
nach Meinung von F. Stammberger meist gedankenlos als
„Grundwasservorräte“
ins Deutsche übersetzt, ohne sich inhaltlich damit auseinander gesetzt
zu haben.
Die Exploitationsvorräte sind in der o.g.
Klassifikation definiert:
„Unter
Exploitationsvorräten werden unterirdische Wassermengen in m3/d
verstanden, die durch in technisch-ökonomischer Hinsicht rationelle
Wasserfassungsanlagen bei einem vorgegebenen Exploitationsregime und bei
einer Wasserqualität erhalten werden können, die im Laufe der
vorgesehenen Wassernutzungszeit den Forderungen entspricht“.
[STAMMBERGER,
F.: s. o.]
Die zu diesem Zeitpunkt bereits geltende „Klassifikation der Exploitationsvorräte des unterirdischen Wassers“ (Moskau
1960) sowie die Instruktion zur Anwendung der „Klassifikation der
Exploitationsvorräte des unterirdischen Wassers“ (Moskau 1961) bezieht
er dennoch in die Grundwasservorratsklassifikation ein, kopiert jene
jedoch nicht. In der DDR führte er dazu den Begriff des Liefervermögens
ein:
„Die in den
Grundwasserlagerstätten berechneten Vorräte und das festgestellte Ausmaß
ihrer Erneuerungsmöglichkeit sind die Grundlage für die Ermittlung der
ständig oder im Laufe eines Zeitraumes zulässigen Entnahmemengen, dem
Liefervermögen (in m3/d) der Grundwasserlagerstätte bzw.
eines ihrer grundwasserführenden Gesteine.“
[Klassifikation
der Grundwasservorräte der Deutschen Demokratischen Republik - 1. Grundwasservorratsklassifikation vom 15.04.1966 - §1 Absatz 5 – Z. angew.
Geol., 12, S. 421 – 423, Berlin 1966]
Für die Gradlinigkeit und die Konsequenz
im Denken und Handeln von F. Stammberger spricht das folgende Zitat aus
seinem o.g. Artikel:
„Es erscheint auch
unrichtig, eine so limitierte Fördermenge als „Vorrat“ zu bezeichnen.
Wir sehen deshalb in unseren Festlegungen gegenüber den
sowjetischen der Jahre 1960/1961 nur
einen Fortschritt in der Formulierung und keinen grundsätzlichen
Unterschied in der Betrachtungsweise.“
[STAMMBERGER,
F.: s. o.]
Ein Ausdruck des langwierigen,
komplizierten Einigungsprozesses zwischen den Bereichen Wasserwirtschaft
und Geologie ist letztendlich die Tatsache, dass die 1. Grundwasservorratsklassifikation
erst am 15.04.1966 in Kraft treten konnte.
Und auch das folgende Zitat ist typisch
für Weitsicht und Cleverness von F. Stammberger:
„Die von der ZVK
herausgegebene erste Grundwasservorratsklassifikation wird in der
nächsten Zukunft ihre Bewährungsprobe bestehen müssen. Die Erfahrung
wird zeigen, ob sie Lücken und ungenügende Festlegungen aufweist. Sie
werden zur gegebenen Zeit ausgebessert werden.“
[STAMMBERGER,
F.: s. o.]
Die im weitere Verlauf jährlich zu
prüfenden und zu entscheidenden Grundwasservorratsberechnungen
erreichten einen Umfang, der ergänzend zum Zentralen Arbeitskreis
Grundwasser der ZVK die Bildung der regionalen Arbeitskreise Nord (Neubrandenburg) und Süd (Dresden) erforderte. In den regionalen
Arbeitskreisen wurden die Grundwasservorratsberechnungen für die
Einzelversorgungen bzw. kleineren und bestehenden Grundwasserfassungen
behandelt.
Im zentralen AK Grundwasser leistete Dr. Herbert Gläßer die Hauptarbeit mit der Überprüfung der
Vorratsberechnungen und der Koordination der externen
Gutachter sowie später auch der
AK Nord und Süd. Eckert Christenfeld hat ihn dabei über fünf Jahre
unterstützt, bevor er zum VEB WAB Berlin wechselte.
Nach dem altersbedingten Ausscheiden von
Friedrich Stammberger aus dem aktiven Berufsleben wurde unter Leitung
von Conrad Goldbecher nach einer zwischenzeitlich erfolgten
Umstrukturierung der dem Ministerrat der DDR bis 1975 direkt
unterstellten ZVK zur Staatlichen Vorratskommission als Organ des
Ministeriums für Geologie die
2. Grundwasservorratsklassifikation mit
Datum vom 28. August 1979 erarbeitet. Sie trat mit Veröffentlichung im
Gesetzblatt der DDR – Sonderdruck 1979 vom 9. November – in Kraft.
Schließlich folgte die
2. Grundwasser-Instruktion
mit Datum vom 1. Mai 1987, bestätigt durch den Minister für Geologie
M. Bochmann.
Bemerkenswert sind die drei Anhänge:
·
Anhang Nr. 1
Anlage 1 zur „Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Geologie und dem
Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft über geologische
Untersuchungsarbeiten auf Grundwasser“ vom 7. Februar 1984: Grundsätze
zur Erarbeitung von Konditionen für die Erkundung und Bestätigung von
Grundwasservorräten.
·
Anhang Nr. 2
Festlegung zum Nachweis von Grundwasservorräten an bestehenden
Wasserwerken, - bestätigt am 01.12.1984 von
Fiedler, Staatssekretär für
Umweltschutz und Wasserwirtschaft sowie
Dr. Goldbecher, Vorsitzender
der Staatlichen Vorratskommission und Staatssekretär für Geologie
·
Anhang Nr. 3
Anlage 4 „Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Geologie und dem
Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft über geologische
Untersuchungsarbeiten auf Grundwasser“ vom 7. Februar 1984:
Grundwassererschließungsarbeiten lokaler Bedeutung.
Der in der 1. Grundwasservorratsklassifikation
sowie in der 1. Grundwasser-Instruktion begrifflich zwar enthaltene
Begriff „zusätzliche Grundwasservorräte“, die durch technische Maßnahmen wie Uferfiltration und Grundwasseranreicherung entstehen, erhielt in der
2. Grundwasservorratsklassifikation sowie später in der 2. Grundwasser-Instruktion
eine eindeutige Aufwertung. Darin spiegelt sich der bereits behandelte
Konflikt zwischen ständig steigendem Wasserbedarf und dem natürlich
begrenzten Wasserdargebot wider. Die Lösung war für die Ballungsgebiete
die Mehrfachnutzung. Diese erfolgte auf Grund der Vorzüge (Schönung des
versickerten Oberflächenwassers, kostengünstig zu schaffender
unterirdischer
Speicherraum u.a.) über die Grundwasseranreicherung und die
Uferfiltration.
An dieser Stelle sei eine kritische
Bemerkung zur Ansicht von F. Stammberger bezüglich der „sich praktisch
nicht erneuernden Vorräte“ oder auch als „statische Vorräte“
bezeichneten passiven Grundwasservolumina erlaubt.
F. Stammberger schreibt in seinem o.g.
Artikel von 1966 auf Seite 419:
„Die als unantastbar
betrachteten sogenannten „statischen Vorräte“, die deshalb nach Meinung
einiger Fachleute auch nicht erkundet, berechnet und klassifiziert
werden sollen, sind keineswegs ein hydrogeologisch - wasserwirtschaftliches Tabu. Tatsächlich werden bei uns, wie in fast
allen Ländern mit großem Wasserbedarf, die „statischen Vorräte bereits
teilweise genutzt. Sie wurden und werden tatsächlich „angetastet. Und
dieses Antasten und sogar ihr völliger Abbau werden zukünftig zunehmen“.
Es geht bei der kritischen Bemerkung um
den Abbau der statischen Vorräte oder besser der „sich praktisch nicht
erneuernden Vorräte“. Diese Grundwasservolumina sind Voraussetzung für
das „In-Gang-halten“ des natürlichen Wasserkreislaufes. Würden diese
Polster nicht existieren, würden die versickernden Niederschlagswässer
in die „ leeren Gesteinskörper“ (Poren, Klüfte oder Hohlräume) absinken
und den rezenten Wasserkreislauf mit allen negativen Folgen für die
Oberflächengewässer, für alle aquatischen Systeme sowie für die
Grundwassergewinnung unterbrechen. Und zwar solange, bis der
Auffüllvorgang wieder die Größe oder Höhe erreicht hat, die zu einem
Abfluss und damit zum wieder „In-Gang-setzen“ des Kreislaufes
Niederschlag - Verdunstung - Abfluss führt. Die großen
Absenkungstrichter des Braukohlenabbaus und die Flutungsproblematik nach
der Auskohlung oder Stilllegung der Tagebaue in der Lausitz, im
mitteldeutschen Revier aber auch im Erftgebiet sind für diesen Prozess
der beste Beweis.
Die Erhaltung dieses Polsters ist damit
für die Bildung und Gewinnung der sich erneuernden Grundwasservorräte
unverzichtbar. Selbstverständlich ist der Begriff „statische oder sich
praktisch nicht erneuernde Vorräte“ eine Abstraktion.
[WEDER,
H.-J.: Z. angew. Geol., 8, S. 401 – 404, Berlin 1962]
Auch diese Wasservolumina unterliegen
gewissen Austauschprozessen, die hydrochemisch, thermisch oder auch
hydrodynamisch verursacht werden. Sie spielen sich jedoch in sehr langen
Zeiträumen ab. Diese Bereiche, meist tiefliegender Grundwasserleiter,
werden in der Literatur verschiedentlich auch als „passive“
Grundwasserzonen im Gegensatz zu den „aktiven“ im Bereich oberer
Grundwasserleiter mit unmittelbaren hydraulischen Verbindungen zu den
Oberflächengewässern bezeichnet
(u. a. von
B. Gabriel
und
G. Ziegler als “schnellfließende und langsamfließende Anteile der
Grundwasserneubildung.“).
Es ist jedoch falsch den statischer
Grundwasservorrat zu definieren “als
Teil des Grundwasservorrates, der nicht genutzt werden kann.“.
[ADAM,
C., GLÄßER, W., HÖLTING, B.: Hydrogeologisches Wörterbuch. – Stuttgart:
Enke, 2000. – 311 S. ISBN 3-13-118271-3]
Die statischen Grundwasservorräte bieten
die Möglichkeit der „Bewirtschaftung“ der Grundwasserlagerstätten, indem
Grundwasser zum Ausgleich von Verbrauchsspitzen mit Entnahmemengen, die
über der durchschnittlichen Größe der sich erneuernden
Grundwasservorräte im Jahresmittel liegen, aus den statischen Vorräten
zeitweilig entnommen werden können, unter der Voraussetzung, dass im
Jahresmittel oder auch einer längeren Periode durch Minderentnahmen ein
Ausgleich erfolgt.
Das wiederum hat F. Stammberger in seinen
Betrachtungen von 1963 richtig gesehen, wenn er im o.g. Zitat von „Antasten“
schreibt. Schließlich wird mit der Definition des von ihm eingebrachten
Liefervermögens in die 1. Grundwasservorratsklassifikation vom 15.4.1966
diesem Aspekt Rechnung getragen:
„Es sind zu berechnen:
3.1 das
konstante Liefervermögen in m3/d;
3.2
das maximale
Liefervermögen in m3/d bezogen auf eine definierte Zeit
während des Spitzenbedarfs;
3.3
das
mittlere Liefervermögen in m3/d bezogen auf den
Jahresdurchschnitt für den Nutzungszeitraum.“
Was wurde aus der
Grundwasservorratsklassifikation und der Grundwasser-Instruktion nach
der "Wende" im Jahr 1990?
Das MfGEO( Ministerium für Geologie) und die StVK hatten kein Pendant in
der Bundesrepublik, sie verloren ihre Funktion.
Der wirtschaftliche Umbruch führte
innerhalb weniger Jahre zu einer Halbierung des Wasserverbrauchs.
Der in der DDR bereits 1962 vollzogenen „Vereinigung“
zwischen Hydrogeologie und Wasserwirtschaft stand in der Bundesrepublik
die strukturelle und methodische
Trennung zwischen Geologie und
Wasserwirtschaft modifiziert noch durch die föderale Struktur und
Eigenständigkeit der Bundesländer gegenüber.
Die Erkundung und Erschließung neuer
Grundwasserressourcen wurde zum Randgeschäft. In den Fokus des
wirtschaftlichen und öffentlichen Interesses rückte die Ermittlung,
Bewertung und Sanierung von ökologischen Altlasten.
Bei der notwendigen Umstellung der
Arbeitsweise der Hydrogeologen war ein deutlicher Vorteil die straffe
Schule der STVK, d.h. die gute methodische Strukturierung der
Grundwassererkundung und Vorratsberechnung sowie die konsequente
Umsetzungskontrolle.
Die Richtlinie 2000/60/EG
des Europäischen Parlaments und Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik – bekannt unter dem Kürzel WRRL – brachte eine Veränderung.
In der Präambel heißt es unter (4):
„Die
europäische Umweltagentur hat am 10. November 1995 einen aktualisierten
Bericht über die Lage der Umwelt in der Europäischen Union für 1995
vorgelegt und auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Gewässer der
Gemeinschaft sowohl in qualitativer als auch quantitativer Hinsicht zu
schützen“
Die Ziele der WRRL für das Grundwasser
sind:
- Vermeidung einer
weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbessrung des Zustands der
aquatischen Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf den
Wasserhaushalt
-
Förderung einer
nachhaltigen Wassernutzung
-
Schrittweise
Reduzierung der Grundwasserverschmutzung und Verhinderung seiner
weiteren Verschmutzung
Artikel 4: Umweltziele
-
Die Mitgliedsstaaten
schützen, verbessern und sanieren alle Grundwasserkörper und
gewährleisten ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und –neubildung
mit dem Ziel, spätestens 2015 einen guten Zustand des Grundwassers und
für alle signifikanten und anhaltenden Trends der
Schadstoffkonzentrationen eine Trendumkehr zu erreichen.
Die erstmalige Beschreibung aller
GW-Körper (GW-Leiter) ist vorzunehmen, um zu beurteilen
„inwieweit
sie genutzt werden und
wie hoch das Risiko ist, dass sie die Ziele gemäß Artikel 4 nicht
erfüllen.“
Die erstmalige Beschreibung ist
flächendeckend vorzunehmen. Die Ergebnisse der erstmaligen Beschreibung
sind
- die Voraussetzung zur
Identifizierung der Gebiete, die eine weitergehende Beschreibung
erfordern, für die
GW-Körper, die keine weitergehende Beschreibung
erfordern, unmittelbar für die Erstellung von Maßnahmenprogrammen nach
Artikel 11,
- Bewirtschaftungsplänen nach Artikel
13 und Anhang VII sowie
-
für die Umsetzung der Bestimmungen
nach Artikel 7, 8 und Anhang V (GW-Monitoring) zu nutzen.
Die erstmalige Beschreibung setzt daher
die Analyse und Bewertung sehr komplexer Zusammenhänge in der Einheit
von
-
Gewässernetz und Klima (Rahmenbedingungen),
-
GW-Leiter (Gefäß),
-
GW-Körper (Volumen),
-
GW-Bedeckung (Schutzaspekt),
-
GW-Neubildung (Regenerierung der
Ressource),
-
GW-Dynamik,
-
GW-Beschaffenheit,
-
Flächennutzung (punktförmige /
diffuse Schadstoffquellen) und Schutzgebiete,
-
grundwasserrelevante Landökosysteme
(FFH, NSG) und Oberflächenwasserkörper sowie
-
GW-Monitoring (Realitätsprüfung)
voraus.
Nach Anhang II der
EG-Wasserrahmenrichtlinie ist die weitergehende Beschreibung derjenigen
GW-Körper (GW-Leiter) vorzunehmen, bei denen im Rahmen der erstmaligen
Beschreibung ein Risiko hinsichtlich der Erreichung der Umweltziele
ermittelt wurde. Eine weitergehende Beschreibung ist auch generell
notwendig bei GW-Körpern, die sich über die Grenze zwischen zwei oder
mehreren Mitgliedstaaten hinaus erstrecken.
Aufgabe der weitergehenden Beschreibung:
1. Eine genauere Ermittlung der
Ursachen und der Beurteilung des Ausmaßes, die Umweltziele nicht
erreichen zu können.
2. Ermittlung der Maßnahmen, die nach
Artikel 11 erforderlich sind, um die Umweltziele bis 2015 zu erreichen.
3. Bei gegebenen Voraussetzungen die
Inanspruchnahme von Ausnahmeregelungen zu begründen (Artikel 4).
Die weitergehende Beschreibung erfordert
eine detaillierte Betrachtung der raumzeitlichen Beschaffenheits- und
Mengenentwicklung im identifizierten GW-Körper bzw. dem zugehörigen
Einzugsgebiet.
Dies bedeutet in erster Linie eine größere
Bearbeitungstiefe der Daten und Informationen, die im Rahmen der
erstmaligen Beschreibung betrachtet wurden.
Rückblick
In der kritischen
Auseinandersetzung mit den Begriffsdefinitionen der Bereiche
Wasserwirtschaft und Geologie 1966 schrieb F. Stammberger:
„Die
Wirtschaft interessiert sich unmittelbar nicht so sehr für die ruhenden
und sich nicht erneuernden Vorräte, sondern dafür, welche Wassermenge
kontinuierlich oder diskontinuierlich (zeitlich begrenzt oder unbegrenzt)
für die Wasserversorgung auf Grundwasserbasis gewonnen werden kann. Das
und nur das ist die Besonderheit des hydrogeologischen
Erkundungsauftrages.
Anders
ausgedrückt: Wenn die Vorräte und die hydrogeologischen Verhältnisse
hinsichtlich des unterirdischen Zuflusses neuer Wassermengen geklärt
wurden, steht vor dem Hydrogeologen eine weitere nur für sein
Arbeitsgebiet zutreffende Aufgabe: Er muß angeben, welche Wasserabgabe
der Schichten des betreffenden Gebietes für eine Nutzung möglich ist.“.
Und weiter:
„Sie
(die
GW-Vorratsklassifikation)
hat nur eine einzige Aufgabe: einheitliche
Grundsätze für die Berechnung und die Klassifizierung festzulegen. Sie
legt weder fest noch erläutert sie , wie das zu geschehen hat.“
[STAMMBERGER,
F.: s. o.]
Rückblickend ist festzustellen,
die GW-Klassifikation der GW-Vorräte und
Instruktion zur Anwendung der Klassifikation bildeten einen
verbindlichen Rahmen für die Vereinheitlichung, Vergleichbarkeit und
Qualitätsverbesserung der GW-Vorratsberechnungen einschließlich ihrer
umfassenden und transparenten Dokumentation.
Die ZVK und später die STVK leisteten bei
der Überwindung der bis 1990 bestehenden Konfliktsituation zwischen
Wasserbedarf und dem naturbedingt limitierten Wasserdargebot einen
hervorragenden Beitrag zur Entwicklung der Hydrogeologie.
Die straffe „Qualitätskontrolle“ der
Vorratsberechnungen war für die Erkundungsgeologen mit einer
Qualifizierung verbunden, die sie befähigte den mit der Zäsur 1990
entstehenden Wechsel der Aufgaben nahtlos und erfolgreich zu meistern.
Schließlich hat sich mit der WRRL die
ganzheitliche Behandlung der Grundwassererkundung in der Einheit von
Grund- und Oberflächenwasserkreislauf, wie sie in der
Grundwasservorratsklassifikation manifestiert war, bestätigt. Mehr noch,
die geologisch-ökonomische Analyse, wie sie von F. Stammberger
eingeführt wurde, findet in den Forderungen der WRRL zur Bestimmung der
Ressourcenkosten und der wirtschaftlichen Analyse eine Fortsetzung.
Bewahren wir uns dieses Wissen und
entwickeln es weiter, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen!
Ausblick:
Der Klimawandel wird in den Regionen, für die ein Rückgang der
Niederschläge und auf Grund der Erwärmung eine gesteigerte Verdunstung
prognostiziert werden, das in den Jahren von 1960 bis Mitte der 90er
Jahre des vorigen Jahrhunderts (Wiederanstiegsprobleme in den ehemaligen
Braunkohlebergbaugebieten) gesammelte Know-how zur sinnvollen und
notwendigen Bewirtschaftung der Grundwasserressourcen unter Einschluss
der sich praktisch nicht erneuernden Vorräte herausfordern.
|